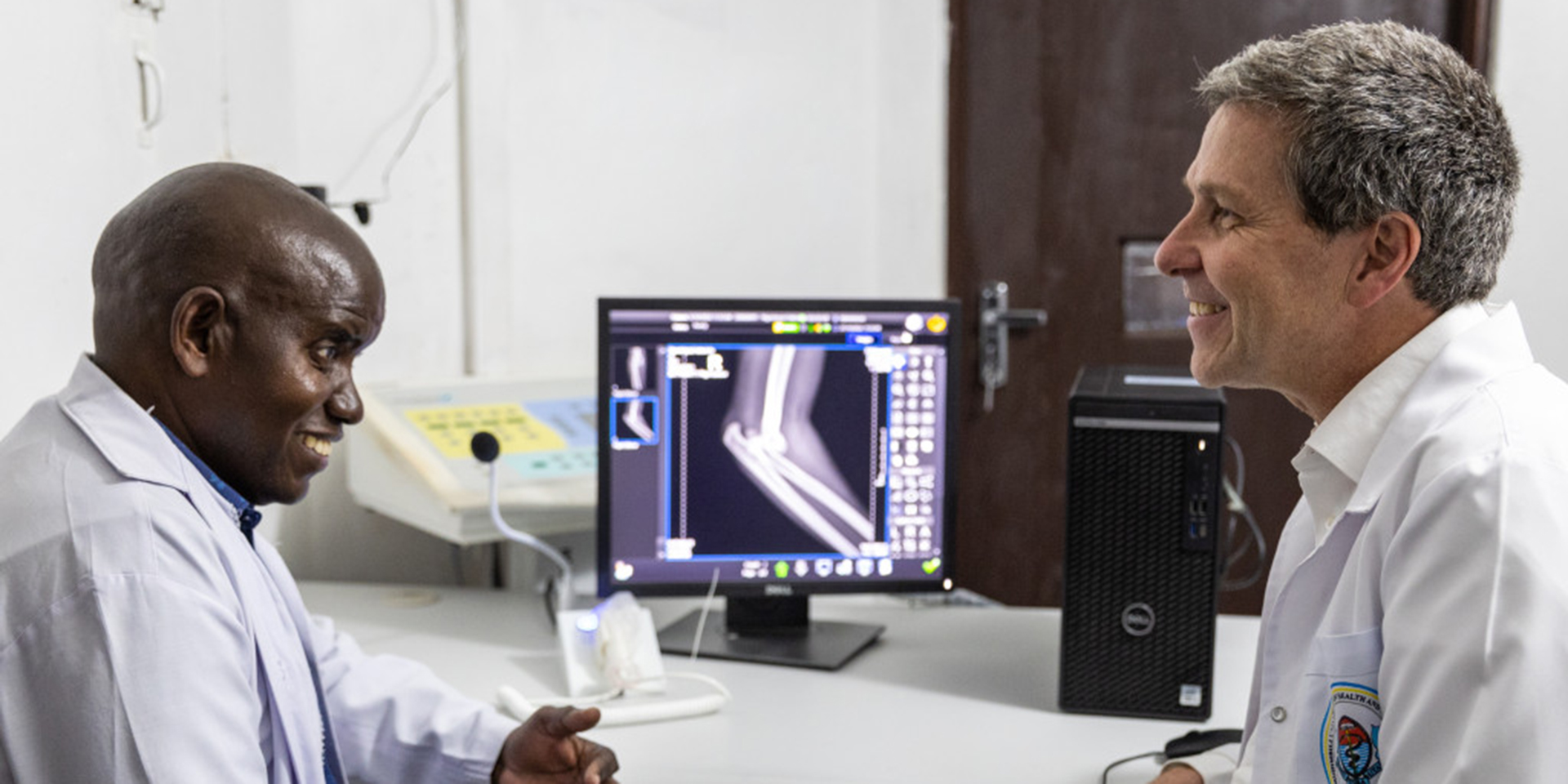Im Einsatz vor Ort für Trost und Gebet: Christian Schmidt, seit sechs Jahren Seemannspfarrer in Singapur.
Bild: ELKB / Poep
Singapur
Christliche Seefahrt und Moderne Sklaverei
Wer die fast endlose Gangway zur "Leverkusen Express" hochsteigen will, darf keine Höhenangst haben. Das 366 Meter lange Containerschiff von Hapag-Lloyd hat nur für ein paar Stunden im Hafen von Singapur festgemacht. Christian Schmidt ist auf dem Weg dorthin. Und Gott sei Dank schwindelfrei.
Vor sechs Jahren war das noch nicht wichtig. Da war er Seelsorger im unterfränkischen Albertshofen. Jetzt ist Christian Schmidt Seemannspfarrer im 10.000 Kilometer entfernten Singapur. 2008 zog der heute 48-Jährige mit Frau und den beiden Kindern vom 2.000-Seelen-Dorf am Main in die Millionenstadt an der Südspitze der malaiischen Halbinsel.
Gigantisch
Singapur ist eine 5,3-Millionen-Einwohner-Stadt am Südende der malaiischen Halbinsel, direkt am Äquator. Hier herrscht tropisches Klima: ganzjährig Temperaturen über 30 Grad, Wassertemperatur: 28 Grad. Die insgesamt fünf Containerhäfen haben eine Kailänge von 15 Kilometern, 300 Großkräne sind dort im Einsatz.
Etwa 90 Prozent des globalen Frachthandels wird in Containerschiffen transportiert, weltweit gibt es rund 4800. Etwa 1600 gehören deutschen Eignern, davon fahren nur 171 Schiffe unter deutscher Flagge. Weltweit arbeiten ca. 1,4 Millionen Seeleute auf Handelsschiffen, der Durchschnittsverdienst beträgt 1400 US-Dollar monatlich. Etwa 14 Millionen Seeleute arbeiten auf Fischereischiffen, 80 Prozent davon in Asien.
Mehr
Weniger
Es ist kurz vor 9 Uhr: Gleich ist Kaffeepause an Bord. Vor dem steilen Weg zum fast 30 Meter hoch liegenden Deck schauen Schmidt und sein singapurischer Kollege David See (46) noch mal in ihren Rucksack: Tageszeitungen, die aktuellen Ausgaben von GEO und „Spiegel“ sowie USB-Sticks sind eingepackt – kleine Geschenke für die Mannschaft.
Vorne und hinten am Schiff hieven riesige Kräne Container auf die Ladefläche. 14.400 davon kann die Leverkusen Express transportieren. 34 Grad Celsius, 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Schmidt, ein unkomplizierter Typ mit offenem Gesicht und kurzen braunen Haaren, trägt eine schwarze Hose und ein weißes Poloshirt mit dem Emblem der Lutherischen Seemannsmission. Dazu Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und eine neongelbe Weste – Vorschrift im Hafen.
Wenig Geld für die Seeleute, kaum Urlaub
Die Räume des Schiffs sind klimatisiert. Treppen, ein Aufzug, helle, teils endlose Gänge mit Neonbeleuchtung. Dann ein großes Büro. Zwei Doppelschreibtische mit Monitor und Tastatur, Aktenschränke. Ein schlanker junger Mann mit weißem Hemd und khakifarbener Jeans begrüßt die beiden Besucher: Kapitän Sebastian Fuchs. Viel Zeit verbringt der Chef der 24-köpfigen Mannschaft mit der Planung der kostengünstigsten Route, die dafür sorgen soll, dass das Schiff pünktlich in den Zielhafen gelangt. Dort ist ein bestimmter Zeitraum zum Anlegen gebucht. Kommt ein Schiff zu spät, ist der Platz besetzt und es muss warten.
Verzögerungen aber kosten Geld. Die Kapitäne spüren den Druck, der auf ihnen und ihren Entscheidungen liegt. Die Frachtpreise sind gering, erklärt Fuchs, weil es viel Konkurrenz gibt. Manche Reedereien lassen deswegen ihre Schiffe unter ausländischer Flagge fahren. Das bedeutet wenig Geld für die Seeleute, kaum Urlaub. Auch die Anforderungen an die technische Sicherheitsausstattung sind wesentlich geringer.
Konfidank 2018: Seemannsmission
Die Lutherische Seemannsmission in Singapur bietet Fischern einen Zufluchtsort. Hier werden Mobiltelefone und Laptops mit Internetzugang zur Verfügung gestellt, damit sie ihren Familien ein Lebenszeichen senden können.Mit Deiner Hilfe können wir den Teufelskreis aus Einsamkeit und Ausbeutung durchbrechen! Unterstütze auch Du die Arbeit der Lutherischen Seemannsmission in Singapur. Deine Hilfe kommt an:
Mission EineWelt
IBAN: DE 12 5206 0410 0001 0111 11
BIC: GENODEF1EK1 (Evangelische Bank eG)
Stichwort: KonfiDank 2018
Mehr
Weniger
Die Leverkusen Express dagegen fährt unter deutscher Flagge. Hier gibt es faire Arbeitsbedingungen. Und die Bezahlung stimmt, sogar zwei Auszubildende sind an Bord. Kapitän Fuchs findet anerkennende Worte für die Arbeit der Seemannspfarrer. „Es ist gut, wenn im Hafen jemand an Bord kommt, der sich mit einem unterhält. Umso schöner, wenn das auch noch in der eigenen Sprache ist.“ Der lockere Plausch zu den Essenszeiten sei hier besonders wichtig, erklärt Schmidt. Denn ansonsten sind die Seeleute weit verteilt auf dem langen Ozeanriesen beschäftigt. Und dort, häufig tief unter Deck, kommt auch ein Pfarrer nur mit Ausnahmegenehmigung hin.
24 Stunden später. Christian Schmidt ist wieder in seinem roten Zafira unterwegs. Singapur hat fünf Containerhäfen mit insgesamt 1.000 Liegeplätzen. Täglich kommen zwischen 600 und 1.400 Schiffe an. Schmidt kennt sich im quirligen Hafengelände aus und kurvt gekonnt an einer langen Schlange wartender Lkws mit Containern vorbei. Er parkt am Heck der Tsingtao Express, ebenfalls aus Deutschland.
"Für die Behörden sind wir Menschen zweiter Klasse"
In der Messe sitzt Chefingenieur Achim Köhler. Der Besuch auf dem Schiff sei extrem wichtig, sagt der „Chief“, wie sie ihn an Bord nennen: „Die Mitarbeiter der Seemannsmission sind die Einzigen, die an Bord kommen und etwas tun für die Mannschaft.“ Alle anderen kämen nur mit Formularen,
Auflagen und Verboten. „Für die Behörden in den Häfen sind wir Seeleute Menschen zweiter Klasse“, sagt Köhler resigniert.
Der Tag geht zu Ende. Nach mehreren Besuchen auf unterschiedlichen Schiffen und ein wenig Bürokram hat Christian Schmidt auf dem Heimweg noch einmal im Fischereihafen angehalten. Im Unterschied zu den Containerhäfen ist dieser allerdings winzig, der Kai ist nicht einmal 100 Meter lang – eine ganz andere Welt.
"Man lernt, Geduld zu haben"
Der Eingang ist streng bewacht. Ohne gültigen Ausweis kommt niemand hinein. Und auch niemand heraus. Grelle orangene Lampen erleuchten den Kai. Vier Schiffe liegen vor Anker. Das eine ist etwa 20 Meter lang, außen weiß, die Innenseite des Vorderdecks ist grün gestrichen. Hitze und die drückende Luftfeuchtigkeit machen den Geruch nach Fisch und Abwasser kaum erträglich. „Das ist unser Problem“, sagt Schmidt und deutet auf das Wasser zwischen Schiffsrumpf und Kaimauer. Undurchsichtig, graubraun, ölig, man sieht Plastikmüll und menschlichen Kot.
„Die Fischer bekommen hier im Hafen kein Frischwasser, es ist dem Kapitän zu teuer. Was bleibt den Fischern übrig? Sie müssen sich mit dem dreckigen Hafenwasser duschen und ihre Kleidung darin waschen.“ Er deutet zur Baracke am Eingang. Dort stehen acht blaue Wasserbehälter. „Mit Spendengeldern kaufen wir ihnen Trinkwasser“, sagt er. „Seit vier Jahren kämpfe ich darum, dass die Hafenbehörde einen Wasserhahn und eine Duschgelegenheit hier auf dem Kai einrichtet.“ Bis jetzt ohne Erfolg. „Man lernt, Geduld zu haben“, sagt er resigniert.
Hintergrund
In Zusammenarbeit mit Mission EineWelt und der Lutherischen Kirche Singapurs bieten Pfarrer Christian Schmidt und seine singapurischen Kollegen Pastor Wilson Wong, David See und Dominic Chan Seeleuten und Fischern ein Stück „Heimat fern der Heimat“. Sie besuchen die Seefahrer direkt an Bord, stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite, geben Halt und Unterstützung in der Fremde, unabhängig davon, woher die Seeleute kommen, was sie glauben oder welche Funktion sie an Bord ausüben. Die beiden von der Seemannsmission ins Leben gerufenen Anlaufstationen im Containerhafen und im Fischereihafen bieten mit ihren Internetzugängen und Telefonen den Seeleuten und Fischern die Möglichkeit, mit ihren Familien und Freunden zu kommunizieren; im Fall von Willkür und Gewalt sind sie der einzige erreichbare Zufluchtsort.
Mehr
Weniger
Schmidts Mitarbeiter Dominic Chan (60) sitzt neben zwei Fischern in der Baracke der Seemannsmission auf dem Kai. Der jüngere hat dichtes schwarzes Haar, strahlend weiße Zähne. Er ist nicht älter als 20, weißes Unterhemd, beige Shorts und Badelatschen aus blauem Plastik. Sie sind gekommen, weil sie hier ihre Handys aufladen können. Das ist eine wichtige Serviceleistung der Seemannsmission für die Fischer: Hier bekommen sie Strom und Internetzugang sowie kostenlose Telefonkarten. Sonst wären sie komplett von ihren Familien abgeschnitten.
Der Kapitän behält die Pässe ein, damit ihm die Leute nicht weglaufen. Sie verdienen offiziell 250 Dollar im Monat, aber er zieht davon die Flugtickets der Anreise ab – und eine Menge anderer „Kosten“. Ob sie nach zwei Jahren an Bord überhaupt etwas ausbezahlt bekommen, ist keineswegs sicher. „Moderne Sklaverei“, nennt das Schmidt. Der bayerische Pfarrer hat Zeitungen mitgebracht, indonesische, philippinische, indische und chinesische. Die Männer auf den Fischerbooten sprechen ganz unterschiedliche Sprachen.
Um sie kümmert sich niemand
Das ist kein Zufall, sondern Taktik der Schiffseigner, sagt Schmidt. So können die Seeleute nicht miteinander reden und sich zusammenschließen, um gegen die schlechten Arbeitsbedingungen
an Bord vorzugehen. Einer der Fischer bewacht mit einem Kollegen ein leeres Schiff, das seit einem
Jahr im Hafen liegt. Die Mannschaft hatte den Eigner auf Zahlung ihres Solds verklagt, worauf das Gericht in Singapur das Schiff beschlagnahmte.
Seit einem Jahr aber ist nichts passiert. Mit einer Spendenaktion sammelte die Lutherische Kirche in Singapur genug Geld, um dem Großteil der Mannschaft die Heimreise bezahlen. Doch zwei mussten bleiben, um das Schiff zu bewachen. Um sie kümmert sich niemand. Schmidt versucht, mit einem der beiden zu reden. Der Fischer kann nur wenige Brocken Englisch. Schmidt holt sein Smartphone heraus. Mit Google Translator können sie ein paar Sätze austauschen.
Am Ende lachen beide.
19.02.2015
Johannes Minkus